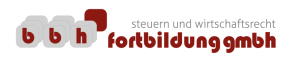Grundsätzlich dürfen alle Menschen aus einem EU/EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz ohne Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung in Deutschland arbeiten.
Für britische Staatsbürger gelten seit dem 1. Januar 2021 aufgrund des Brexits allerdings Sonderregelungen. Sie benötigen einen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. Diese werden von der zuständigen Ausländerbehörde erteilt.
Wann muss ein Minijobber aus dem EU-Ausland bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden?
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen zunächst klären, ob für die Beschäftigung das deutsche Sozialversicherungsrecht gilt. Nur dann ist die Beschäftigung bei der Minijob-Zentrale anzumelden. Die Entscheidung darüber, welches Recht anzuwenden ist, trifft jedoch nicht die Minijob-Zentrale.
Unser Schaubild und die Übersicht über die zuständigen Stellen bietet Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine Hilfestellung bei der Beurteilung von Minijobbern aus dem EU-Ausland. Die einzelnen Schritte erklären wir im Folgenden:
- Soziale Absicherung im Heimatland klären
Erste Anhaltspunkte darüber, ob eine Minijobberin oder ein Minijobber aus dem EU-Ausland bei der Minijob-Zentrale anzumelden ist, erhalten Arbeitgeber durch die Entsendebescheinigung A1. Diese Bescheinigung stellt der ausländische Sozialversicherungsträger für die Beschäftigten aus. Sie bestätigt die soziale Absicherung im Herkunftsland.
Reichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der Aufnahme der Beschäftigung die A1-Bescheinigung beim Arbeitgeber ein, gelten die Regelungen des ausländischen Sozialversicherungsträgers. Der Minijob darf in diesem Fall nicht bei der Minijob-Zentrale gemeldet werden.
Eventuell fallen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Abgaben zur ausländischen Sozialversicherung an. Hilfestellung und Informationen über die dann geltenden Regelungen gibt es bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA).
Können Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer keine Entsendebescheinigung A1 vorlegen, müssen Arbeitgeber überprüfen, ob neben dem Minijob weitere Beschäftigungen ausgeübt werden.
- Es liegen keine weiteren Beschäftigungen vor
Wohnsitz in Deutschland
Wohnen und arbeiten Minijobberinnen und Minijobber ausschließlich in Deutschland, ist der Minijob grundsätzlich an die Minijob-Zentrale zu melden. Die gesetzliche Krankenkasse der Minijobberin oder des Minijobbers entscheidet über die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften. Ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in Deutschland nicht gesetzlich krankenversichert, übernimmt die Prüfung der zuständige Rentenversicherungsträger.
Wohnsitz im Ausland
Befindet sich der Wohnsitz der Minijobberin oder des Minijobbers in einem EU/EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz, gilt ebenfalls grundsätzlich das deutsche Sozialversicherungsrecht. Die Entscheidung darüber trifft allerdings der ausländische Sozialversicherungsträger.
- Es liegen weitere Beschäftigungen vor
Wohnsitz in Deutschland
Wird eine weitere Beschäftigung in einem anderen EU/EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz ausgeübt, gilt grundsätzlich: Bei einem Wohnsitz in Deutschland ist der Minijob an die Minijob-Zentrale zu melden. Die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften müssen sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von der DVKA bestätigen lassen.
Wohnsitz im Ausland
Anders verhält es sich, wenn sich der Wohnsitz der ausländischen Arbeitskraft weiterhin im EU/EWR-Heimatland befindet. Es gilt dann grundsätzlich das Sozialversicherungsrecht des Wohnsitzstaates. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber melden den Minijob nicht an die Minijob-Zentrale. Eventuell fallen Abgaben an den zuständigen Sozialversicherungsträger des Heimatlandes an.
Sind ausländische Minijobber automatisch in Deutschland krankenversichert?
Ist der Minijob an die Minijob-Zentrale zu melden, haben Beschäftigte nicht automatisch einen Kranken- und Pflegeversicherungsschutz in Deutschland.
Sofern sie also nicht bereits in Deutschland kranken- und pflegeversichert sind, müssen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse in Verbindung setzen. Diese prüft dann, welche Absicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung in Frage kommt.
Zahlen Arbeitgeber die üblichen Pauschalbeiträge?
Ist die Minijobberin oder der Minijobber in Deutschland gesetzlich krankenversichert bzw. erfüllt hierfür die Voraussetzungen, zahlen Arbeitgeber auch den Pauschalbeitrag von 13 Prozent. Ansonsten muss der Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung nicht gezahlt werden.
Der Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 Prozent ist durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber grundsätzlich zu zahlen, wenn der Minijob bei der Minijob-Zentrale gemeldet wird.
Besteht für Minijobber aus dem Ausland Rentenversicherungspflicht?
Ja, für Minijobberinnen und Minijobber aus dem EU-Ausland besteht Rentenversicherungspflicht im Minijob mit Verdienstgrenze. Die gezahlten Beiträge begründen unter bestimmten Voraussetzungen einen späteren Rentenanspruch sowohl in Deutschland als auch im Heimatland.
Eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist möglich. Nähere Informationen erhalten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in unserem Magazin-Beitrag „Rentenversicherung im Minijob: Was gilt für die Befreiung?“.
Gibt es besondere Regelungen für bestimmte Personenkreise?
Besondere Regelungen gibt es zum Beispiel für ausländische Studentinnen und Studenten, Praktikanten, Saisonarbeitskräfte sowie für Minijobber, die in einem Privathaushalt tätig sind.
Studenten und Praktikanten
Für Studentinnen und Studenten aus dem EU-Ausland, die in ihrem Heimatland an einer Hoch- oder Fachhochschule eingeschrieben sind und einen Minijob in Deutschland ausüben, gelten grundsätzlich die Minijob-Regelungen nach deutschem Recht. Gleiches gilt auch bei der Ausübung eines freiwilligen Praktikums in Deutschland. Der Minijob ist bei der Minijob-Zentrale anzumelden.
Haben sich Minijobberinnen und Minijobber im Rahmen des freiwilligen Praktikums während ihrer Beschäftigung von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, zahlen Arbeitgeber keinen Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung.
Saisonarbeitskräfte
Ausländische Saisonarbeitskräfte werden überwiegend in der Landwirtschaft benötigt. In den meisten Fällen werden diese Beschäftigungen nur für einen befristeten Zeitraum ausgeübt. Dann handelt es sich oft um einen kurzfristigen Minijob. Detaillierte Informationen zum kurzfristigen Minijob finden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in unserem Magazin-Beitrag „Kurzfristige Minijobs: Erntehelfer haben jetzt Saison“.
Vor Beschäftigungsbeginn müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber prüfen, ob die Saisonarbeitskraft eine Beschäftigung in ihrem Herkunftsland ausübt. Liegt keine weitere Beschäftigung vor, gilt deutsches Recht. Die Beschäftigung kann dann unter Einhaltung der Voraussetzungen als kurzfristige Beschäftigung bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden.
Damit Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versicherungsrechtlich auf der sicheren Seite sind, stehen Fragebögen in unterschiedlichen Sprachen auf der Internetseite der Minijob-Zentrale zur Verfügung.
Minijobber im Privathaushalt
Bei einem Minijob im Privathaushalt gelten die gleichen Voraussetzungen wie für einen Minijob im gewerblichen Bereich.
Für die Anmeldung nutzen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber jedoch den sogenannten Haushaltsscheck oder alternativ den Minijob-Manager.